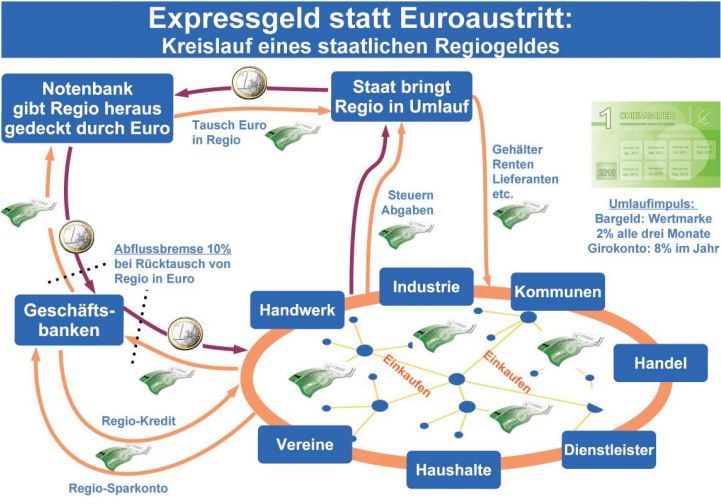Die Zeit hatte einen absolut lesenswerten Artikel über Schattenwirtschaft am Hamburger Hauptbahnhof. Ich habe in Bremen studiert und kenne das Prozedere: An den Fahrkartenautomaten stehen “Kleinunternehmer”, die Mitfahrer für das Länderticket suchen. Das machen sie den ganzen Tag und verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Eine sehr spannende Form der informellen Ökonomie:
Solche informellen Ökonomien florieren laut Robert Neuwirth besonders in Krisenzeiten. Der amerikanische Schattenmarktexperte argumentiert, dass sie eben nicht nur aus Drogen- oder Waffenschmuggel bestünden, sondern vor allem aus Produktpiraterie. Und aus Tausch- und Teilgeschäften. Damit sind die Händler vom Hauptbahnhof auch die Schattenseite der Idee voncollaborative consumption: Sie haben aus dem Teilen ein Geschäftsmodell gemacht. Die Untergrundökonomien füllen nach Neuwirth effektiv Lücken im offiziellen System und funktionieren nach eigenen, ungeschriebenen Gesetzen.
(..)
In ihrer Wahrnehmung versorgten sie ihre Familien und stellten sogar noch Leute ein – völlig ohne staatliche Unterstützung. In den informellen Ökonomien, stellt Neuwirth anerkennend fest, gediehen Unternehmergeist und Erfindungsreichtum. Es sei Zeit, hinzuschauen, was die anzubieten hätten, die im Verborgenen arbeiten.
Den angesprochenen Unternehmergeist kann ich jeden Tag vor meiner Haustüre in Berlin Wedding beobachten. Ich bin immer wieder auf’s neue beeindruckt: Flaschensammler, die sich organisieren und per Aushang anbieten “Leergut zu festen Zeiten direkt von Zuhause abzuholen“, andere bieten im Tausch ihre eigene “Arbeitskraft gegen Nachhilfeunterricht für den Sohn“.
Beim Einkauf im Real ist mir neulich ein älterer Herr begegnet, der vor den Kassen steht und versucht “fremde Einkäufe auf seine Payback-Karte zu buchen” und im Gegenzug beim Tüten packen zu helfen. Pro Euro Umsatz bekommt er 0,5 Paybackpunkte. Pro Paybackpunkt einen Cent am Auszahlautomaten. Mein Einkauf hat ihm etwa 70 Cent gebracht.
Auch bei meiner letzten Fahrt von Berlin nach Stuttgart mit der Mitfahrzentrale war ein spannender informell ökonomischer Ansatz im Spiel: Zwei Studenten haben sich einen alten Sprinter mit 9 Sitzplätzen gekauft – und fahren nicht mal mehr selbst. Einer der Mitfahrer bekommt “das Angebot, den Wagen selbst zu fahren“, mit offiziellem “privaten Mietvertrag”.
Im Gegenzug fährt er natürlich kostenlos. Alle anderen bezahlen regulär. Einer der zwei Studenten hat in Berlin kassiert und eine gute Fahrt gewünscht. Der andere andere hat uns (und sein Auto) in Stuttgart in Empfang genommen. Mit Fahrplan und festen Abfahrtszeiten ist der Sprinter so 24/7 auf der Straße.
Alles kleine Beispiel, wie Wirtschaft mit Vertrauen, Einfallsreichtum und Unternehmergeist als Grundlage auch funktionieren kann. Ähnliche Ansätze gab es hier schon einmal: Vertrauen ist die Währung für echte Alternativen.